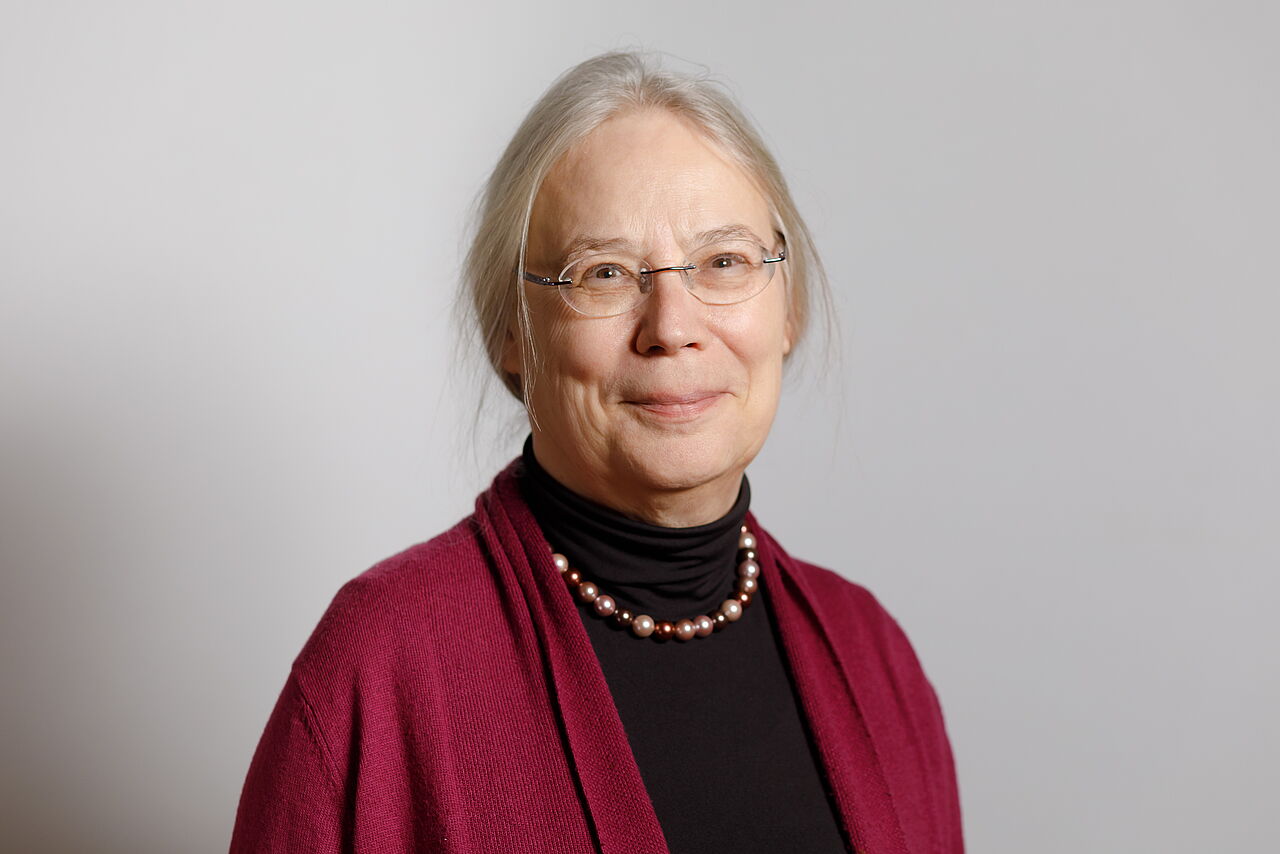
Prof. Dr. Dorothea Redepenning
Musikwissenschaft
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Musikwissenschaftliches Seminar
Augustinergasse 7
69117 Heidelberg
E-Mail dorothea.redepenning(at)zegk.uni-heidelberg.de
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/muwi/dozenten/redepenning.html
Dorothea Redepenning, Musikstudium und Studium der Musikwissenschaft, Germanistik, Romanistik in Hamburg, 1984 Promotion, wissenschaftliche Mitarbeiterin am DFG-Projekt Liszt-Schriften in Detmold, Lehrbeauftragte für »Slawische Musikkulturen« an der Universität Hamburg, 1993 Habilitation, Vertretungsprofessuren in Marburg und Erlangen, seit 1997 Professorin an der Universität Heidelberg; 1999 bis 2002 Mitherausgeberin der Zeitschrift »Die Musikforschung«; Fachbeirätin bei der Neu-Edition der »Musik in Geschichte und Gegenwart«, 2000 bis 2008 Studiendekanin der Philosophischen Fakultät der Universität Heidelberg, Mitglied im 2008 eröffneten Exzellenzcluster »Asia and Europe in a Global Context: Shifting Asymmetries in Cultural Flows«.
Forschungsschwerpunkte
- Die Musik Osteuropas, besonders Russlands, der Sowjetunion und der postsowjetischen Zeit
- Die Musik des 19. und 20. Jahrhunderts
- Symphonie, Programm-Musik, Oper
- Rezeptionsgeschichtliche Fragestellungen
- Interkulturelle Prozesse und Kulturtransfer
Traumrelevante Publikationen
Aufsätze
- Musik und Katastrophe – Katastrophenmusik. In: Gerrit Jasper Schenk, Monica Juneja, Alfred Wieczorek u. Christoph Lind (Hrsg.): Mensch. Natur. Katastrophe. Von Atlantis bis heute (= Publikationen der Reiss-Engelhorn-Museen Bd. 62). Regensburg: Schnell & Steiner 2014. S. 129–133.
- Inszenierungen von Männlichkeit und Gewalt (am Beispiel von Opern der Kriegszeit). In: Stefan Hahnheide, Dietrich Helms, Claudia Glunz u. Thomas F. Schneider (Hrsg.): Musik bezieht Stellung. Funktionalisierungen der Musik im Ersten Weltkrieg. Göttingen: V&R Unipress 2013. S. 333–344.
- Musik und Politik in der jungen Sowjetunion. In: Axel Schröter u. Daniel Ortuño-Strühring (Hrsg.): Musik – Politik – Ästhetik. Detlef Altenburg zum 65. Geburtstag. Sinzig: 2012. Studio. S. 139–157.
- Die Symphonie als imaginäre Bühne. In: dies. u. Joachim Steinheuer (Hrsg.): Inszenierung durch Musik. Kassel: Bärenreiter 2011. S. 317–335.
- Kaščej Bessmertnyj – Unhold Ohneseel. Seele und Unsterblichkeit oder Die beseelte Natur in Rimskij-Korsakovs phantastischen und Märchenopern. In: Aleksej Rukavašnikov (Hrsg.): Das Problem der Seele und des Körpers in Philosophie und Wissenschaft / Проблема души и тела в философии и науке. St. Petersburg: Universitätsverlag 2011. S. 143–151 (russisch von A. Rukavašnikov).
- Das Wunderhorn als Vorschule symphonischer Ästhetik. Zur Wunderhorn-Thematik in Gustav Mahlers Symphonien. In: Antje Tumat und Internationales Musikfestival Heidelberger Frühling: Von Volkston und Romantik. Des Knaben Wunderhorn in der Musik. Heidelberg: Winter 2008. S. 157–171.
Herausgeberschaften
- zusammen mit Joachim Steinheuer (Hrsg.): Mnemosyne. Zeit und Gedächtnis in der europäischen Musik des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Saarbrücken: Pfau 2006.
- zusammen mit Annette Kreutziger-Herr (Hrsg.): Mittelaltersehnsucht? Texte des interdisziplinären Symposions zur musikalischen Mittelalterrezeption an der Universität Heidelberg, April 1998. Kiel: Vauk 2000.
Traumrelevante Vorträge & Konferenzen
Mai 2015
Träume in Richard Strauss‘ Melodram Enoch Arden, Saarbrücken
Traumrelevante Lehrveranstaltungen
SoSe 2015
Vorlesung im Rahmen der Ringvorlesung des GRK »Europäische Traumkulturen« zum Thema»Interdisziplinäres Traumdenken. Theorien und Methoden«; Vortragstitel: »Musik«
Hauptseminar »Traumdarstellungen in der Musik«


